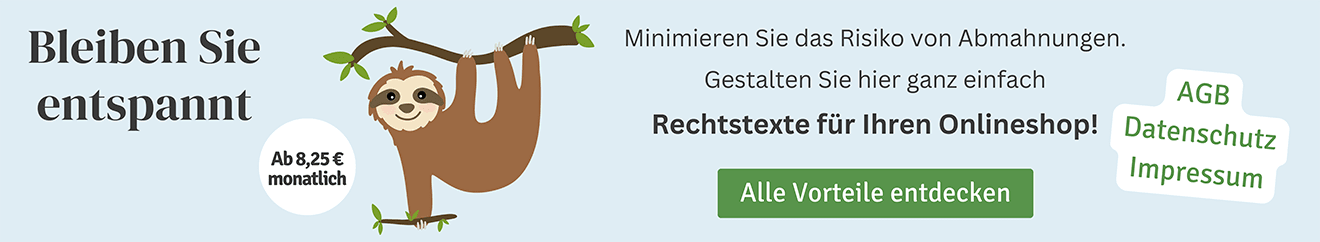Textilien richtig kennzeichnen – Textilkennzeichnungs-VO
Wenn Sie im Internet textile Artikel anbieten, müssen Sie die Regelungen der EU-Textilkennzeichnungsverordnung (EU-TextilkennzVO) beachten. Von den Definitionen für Textilien bis hin zur präzisen Angabe von Faseranteilen - dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick und praktische Tipps, um Ihre Produkte rechtssicher zu kennzeichnen. Sichern Sie sich das nötige Wissen für Ihren Onlineshop und erfahren Sie alles über die Textilkennzeichnung!

Was sind Textilien im Sinne der Textilkennzeichnungsverordnung?
Textilien im Sinne der EU-TextilkennzVO sind Produkte, die zu mindestens 80 % ihres Gesamtgewichts oder des Gewichts ihrer stofflichen Bestandteile aus textilen Rohstoffen bestehen.
Textile Rohstoffe sind Fasern, die sich verspinnen oder zu textilen Flächengebilden (Stoffen) verarbeiten lassen. Zu den Fasern zählen sowohl natürliche (z.B. Baumwolle, Flachs, Seide) als auch künstliche (z.B. Polyester). Waren, die zu weniger als 80 Gewichtsprozent aus textilem Rohstoff bestehen, fallen nicht unter die Verordnung.
Lederwaren fallen demnach nicht unter die Textilkennzeichnungsverordnung.
Anforderungen der Textilkennzeichnungsverordnung
Die Textilkennzeichnungsverordnung stellt klare Anforderungen an die Kennzeichnung von Textilien, die im Handel angeboten werden. Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden und Transparenz für Ihre Kunden zu gewährleisten, müssen Sie die folgenden wesentlichen Punkte berücksichtigen:
- Ihre Artikelbeschreibung muss eine korrekte Textilkennzeichnung enthalten.
- Die Textilkennzeichnung muss alle Fasern aufführen, die im Artikel enthalten sind.
- Die enthaltenen Fasern sind in absteigender Reihenfolge ihres Gewichts aufzuführen.
- Sie dürfen nur diejenigen Faserbbezeichnungen aufführen, die in Anlage I der Verordnung aufgeführt sind (siehe unten)
- Im Regelfall muss die Textilkennzeichnung sowohl in der Artikelbeschreibung im Onlineshop als auch auf dem Produkt selbst dauerhaft angebracht sein (z.B. als angenähtes Etikett oder einen sonstigen Aufnäher)
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anforderungen finden Sie in den folgenden Absätzen:
Inhalt, Sprache und Anbringung der Textilkennzeichnung
Die EU-TextilkennzVO enthält einen Katalog zulässiger Materialnamen (Anhang I (ab Seite 12) der EU-TextilkennzVO). Nur diese Materialnamen dürfen Sie verwenden. Fantasiebezeichnungen wie „Flauschfaser“ oder „Kuschelstoff“ kommen für das Etikett also nicht in Frage. Ebenfalls nicht erlaubt sind Abkürzungen der amtlichen Bezeichnungen.
Aufschlüsselung nach Gewichtsanteil
Der Gewichtsanteil jeder Faserart muss in Prozent angegeben werden, bezogen auf das Gewicht des textilen Teils des Produkts. Andere Bestandteile wie Leder- oder Metallapplikationen werden dabei nicht zum Gesamtgewicht gezählt. Bei einem Produkt aus nur einer Faserart kann statt „100%“ auch „rein“ oder „ganz“ verwendet werden. Enthält das Produkt mehrere Faserarten, sind diese in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufzuführen. Das bedeutet, dass die Faser mit dem größten Anteil zuerst genannt wird.
Beispiel: Ein Pullover besteht zu 70% aus Baumwolle und zu 30% aus Polyester. In der Kennzeichnung muss daher „70% Baumwolle, 30% Polyester“ stehen.
Leder- oder Horn-Applikationen
Enthalten Textilien Teile tierischen Ursprungs, z.B. Lederaufnäher oder Knöpfe aus Horn, müssen Sie hierauf mit dem Zusatz „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ hinweisen.
Sprache, Lieferung ins Ausland
Die Kennzeichnung muss in derjenigen Amtssprache gefasst sein, die im Land Ihres Käufers gilt. Wenn Sie beispielsweise nach Frankreich liefern, müssen Sie zusätzlich die französischen Fasernamen nennen. Das gilt nicht nur für das Etikett, sondern auch für die Produktbeschreibung im Onlineshop. Achten Sie also auf eine korrekte Übersetzung.
Feste Anbringung
Die Textilkennzeichnung muss am Produkt so angebracht sein, dass sie „dauerhaft, sichtbar, zugänglich und leicht lesbar“ ist (§ 14 EU-TextilkennzVO). Das Schriftbild muss „in Bezug auf Schriftgröße, Stil und Schriftart einheitlich“ sein (§ 16 EU-TextilkennzVO). In der Regel müssen die Informationen sowohl direkt im oder am Produkt selbst angebracht sein (z.B. als Etikett oder Aufdruck) sowie in der Online-Produktbeschreibung.
Kennzeichnung von Stoffen als Meterware
Wenn Sie Stoff als Meterware verkaufen, braucht der verkaufte Stoffabschnitt selbst nicht etikettiert zu sein. Anstelle eines Etiketts muss die Lieferung dann aber eine Rechnung, einen Lieferschein oder ein sonstiges Begleitdokument mit den Angaben der Textilkennzeichnung enthalten.
Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht
Globale Kennzeichnung
Einige Produkte benötigen lediglich eine Kennzeichnung im Online-Shop und müssen nicht zusätzlich auf dem Produkt selbst gekennzeichnet werden. Dies wird als „globale Kennzeichnung“ bezeichnet. Zu diesen Produkten gehören unter anderem Gürtel, Hosenträger, Schnürsenkel, Ziertaschentücher und Waschhandschuhe (siehe Anhang VI der EU-TextilkennzVO).
Hier ist eine Übersicht der Erzeugnisse, für die gemäß Anhang VI der Verordnung eine „globale Kennzeichnung“ ausreicht:
- Scheuertücher
- Putztücher
- Bordüren und Besatz
- Borten
- Gürtel
- Hosenträger
- Strumpf- und Sockenhalter
- Schnürsenkel
- Bänder
- Gummielastische Bänder
- Verpackungsmaterial, neu und als solches verkauft
- Schnüre für Verpackungen und landwirtschaftliche Verwendungszwecke; Schnüre, Seile und Taue, die nicht unter Anhang V Nummer 37 fallen
- Für diese Erzeugnisse, die als Schnittstücke verkauft werden, gilt die globale Etikettierung der Rolle.
- Seile und Taue gemäß dieser Nummer umfassen insbesondere Seile und Taue für den Alpinismus und den Wassersport.
- Deckchen
- Taschentücher und Ziertaschentücher
- Haarnetze
- Krawatten und Fliegen für Kinder
- Lätzchen, Seiflappen und Waschhandschuhe
- Nähgarne, Stopfgarne und Stickgarne, die in kleinen Einheiten für den Einzelverkauf aufgemacht sind und deren Nettogewicht 1g nicht überschreitet
- Gurte für Vorhänge und Jalousien
Vollständig von der Kennzeichnungspflicht ausgenommene Produkte
Es gibt auch Produkte, die von der Kennzeichnungspflicht vollständig ausgenommen sind. Dazu gehören z.B. kleine Hüllen für Mobiltelefone (bis zu einer Oberfläche der Hülle von 160 Quadratzentimetern), Stoffblumen, gebrauchte Kleidung, Etuis (für Brillen, Zigaretten und Feuerzeuge), Uhrenarmbänder und Spielzeug (siehe Anhang V der EU-TextilkennzVO).
Hier finden Sie die gemäß Anhang V der Verordnung von der Kennzeichnungspflicht vollständig ausgenommenen Erzeugnisse:
- Hemdsärmelhalter
- Armbänder für Uhren, aus Spinnstoffen
- Etiketten und Abzeichen
- Polstergriffe, aus Spinnstoffen
- Kaffeewärmer
- Teewärmer
- Schutzärmel
- Muffe, nicht aus Plüsch
- Künstliche Blumen
- Nadelkissen
- Bemalte Leinwand
- Textilerzeugnisse für Verstärkungen und Versteifungen
- Gebrauchte, konfektionierte Textilerzeugnisse, sofern sie ausdrücklich als solche bezeichnet sind
- Gamaschen
- Verpackungsmaterial, nicht neu und als solches verkauft
- Leder- und Sattlerwaren, aus Spinnstoffen
- Reiseartikel, aus Spinnstoffen
- Fertige oder noch fertigzustellende handgestickte Tapisserien und Material zu ihrer Herstellung, einschließlich Handstickgarne, die getrennt vom Grundmaterial zum Verkauf angeboten werden und speziell zur Verwendung für solche Tapisserien aufgemacht sind
- Reißverschlüsse
- Mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen
- Buchhüllen aus Spinnstoffen
- Spielzeug
- Textile Teile von Schuhwaren
- Deckchen aus mehreren Bestandteilen mit einer Oberfläche von weniger als 500 cm²
- Topflappen und Topfhandschuhe
- Eierwärmer
- Kosmetiktäschchen
- Tabakbeutel aus Gewebe
- Futterale bzw. Etuis für Brillen, Zigaretten und Zigarren, Feuerzeuge und Kämme, aus Gewebe
- Hüllen für Mobiltelefone und tragbare Medienabspielgeräte mit einer Oberfläche von höchstens 160 cm²
- Schutzartikel für den Sport, ausgenommen Handschuhe
- Toilettenbeutel
- Schuhputzbeutel
- Bestattungsartikel
- Einwegerzeugnisse, ausgenommen Watte
- Den Vorschriften des Europäischen Arzneibuchs unterliegende Textilerzeugnisse, für die ein entsprechender Vermerk aufgenommen wurde, wieder verwendbare medizinische und orthopädische Binden und allgemeines orthopädisches Textilmaterial
-
Textilerzeugnisse, einschließlich Seile, Taue und Bindfäden (vorbehaltlich Anhang VI Nummer 12), die normalerweise bestimmt sind:
- zur Verwendung als Werkzeug bei der Herstellung und der Verarbeitung von Gütern;
- zum Einbau in Maschinen, Anlagen (für Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung usw.), Haushaltsgeräte und andere Geräte, Fahrzeuge und andere Transportmittel oder zum Betrieb, zur Wartung oder zur Ausrüstung dieser Geräte, mit Ausnahme von Planen und Textilzubehör für Kraftfahrzeuge, das getrennt von den Fahrzeugen verkauft wird
-
Textilerzeugnisse für den Schutz und die Sicherheit, wie z. B.:
- Sicherheitsgurte, Fallschirme, Schwimmwesten, Notrutschen
- Brandschutzvorrichtungen, kugelsichere Westen
- besondere Schutzanzüge (z. B. Feuerschutz, Schutz vor Chemikalien oder anderen Sicherheitsrisiken)
- Ballonhallen (Sport-, Ausstellungs-, Lagerhallen usw.), sofern Angaben über die Leistungen und technischen Einzelheiten dieser Erzeugnisse mitgeliefert werden
- Segel
- Textilwaren für Tiere
- Fahnen und Banner
Beispiele für korrekte Textilkennzeichnungen
“70% Baumwolle
30% Seide”
– oder –
“60% Baumwolle
25% Jute
15% Viskose”
– oder –
“100% Baumwolle”
Pflegekennzeichnung – Pflegesymbole für Textilien
In Deutschland, Frankreich und der Schweiz besteht keine Pflicht, Pflegehinweise (z.B. „maschinenwaschbar bis 40 °C“, „nicht bügeln“, „nicht chemisch reinigen“ etc.) anzubringen. Dennoch empfehlen wir solche kurzen Hinweise (ohne Symbole), um eine falsche Behandlung durch den Käufer und daraus resultierende Reklamationen zu vermeiden.
In Österreich ist die Anbringung von Pflegesymbolen verpflichtend. Auf die Symbole erhebt der Verband GINETEX (Groupement International d‘Etiquetage pour l‘Entretien des Textiles) allerdings markenrechtlichen Schutz. Informationen zum Erwerb einer Nutzungslizenz finden Sie auf der Webseite des Verbandes (www.ginetex.net).
Weiteres zu Produktbeschreibungen
Welche Angaben außer der Textilkennzeichnung in Ihrer Produktbeschreibung noch wichtig sind, lesen Sie in unserem Artikel über Produktbescheibungen in Onlineshops.
Liste der zulässigen Faserbezeichnungen
Natürliche Tierfasern
- Wolle: Faser vom Fell des Schafes (Ovis aries) oder ein Gemisch aus Faser von der Schafschur und Haaren der unter Nummer 2 genannten Tiere.
- Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmir, Mohair, Angora(-Kanin), Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgora, Biber, Fischotter: Haare dieser Tiere können mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung "Wolle" oder "Tierhaar" verwendet werden.
- Tierhaar: Mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z.B. „Rinderhaar“, „Hausziegenhaar“, „Roßhaar“): Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt sind.
- Seide: Faser, die ausschließlich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen wird.
Pflanzliche Fasern
- Baumwolle: Faser aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium).
- Kapok: Faser aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra).
- Flachs/Leinen: Bastfaser aus den Stengeln des Flachses (Linum usitatissimum).
- Hanf: Bastfaser aus den Stengeln des Hanfes (Cannabis sativa).
- Jute: Bastfaser aus den Stengeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsularis. Im Sinne der Verordnung sind der Jute gleichgestellt: Faser aus Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicenniae, Urena lobata, Urena sinuata.
- Manila: Faser aus den Blattscheiden der Musa textilis.
- Alfa: Faser aus den Blättern der Stipa tenacissima.
- Kokos: Faser aus der Frucht der Cocos nucifera.
- Ginster: Bastfaser aus den Stengeln des Cytisus scoparius und/oder des Spartium junceum.
- Ramie: Faser aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima.
- Sisal: Faser aus den Blättern der Agave sisalana.
- Sunn: Faser aus dem Bast der Crotalaria juncea.
- Henequen: Faser aus dem Bast der Agave Fourcroydes.
- Maguey: Faser aus dem Bast der Agave Cantala.
Chemisch hergestellte Fasern
- Acetat: Faser aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92%, jedoch mindestens 74% acetylierter Hydroxylgruppen.
- Alginat: Faser aus den Metallsalzen der Alginsäure.
- Cupro: Regenerierte Zellulosefaser nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren.
- Modal: Nach einem geänderten Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser mit hoher Reißkraft und hohem Modul in feuchtem Zustand.
- Regenerierte Proteinfaser: Faser aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiß.
- Triacetat: Aus Zellulose-Acetat hergestellte Faser, bei denen mindestens 92% der Hydroxylgruppen acetyliert sind.
- Viskose: Bei Endlosfaser und Spinnfaser nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser.
Elastische Fasern
- Elasthan: Elastische Faser, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan bestehen.
- Elastomultiester: Faser, die durch die Interaktion von zwei oder mehr chemisch verschiedenen linearen Makromolekülen in zwei oder mehr verschiedenen Phasen entsteht.
- Elastolefin: Faser aus mindestens 95 Gewichtsprozent Makromolekülen, zum Teil quervernetzt, zusammengesetzt aus Ethylen und wenigstens einem anderen Olefin.
Sonstige Fasern
- Glasfaser: Faser aus Glas.
- Polypropylen / Polyamid-Bikomponentenfaser: Bikomponentenfaser, die zu 10 bis 25 Gewichtsprozent aus in eine Polypropylenmatrix eingebetteten Polyamidfibrillen besteht (vgl. EU-Verordnung 286/2012).
- Polyacrylat: Faser aus quervernetzten Makromolekülen, die aus mehr als 35 Gewichtsprozent Acrylatgruppen (Säure, Leichtmetallsalze oder Ester) und weniger als 10 Gewichtsprozent Acrylnitrilgruppen in der Kette und bis zu 15 Gewichtsprozent Stickstoff in der Quervernetzung aufgebaut wird (vgl. EU-Verordnung 2018/122).