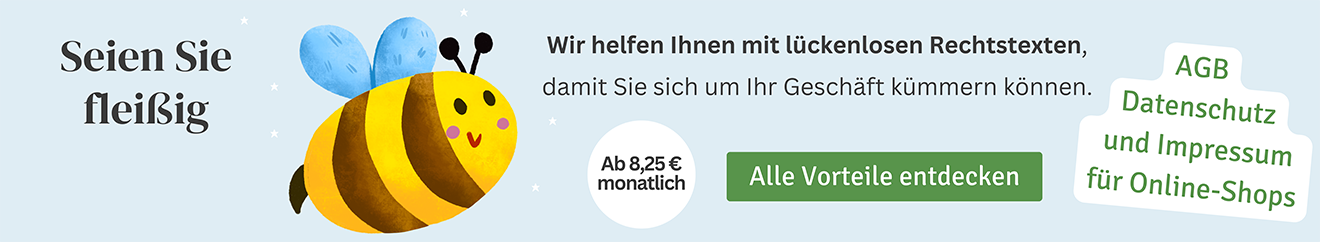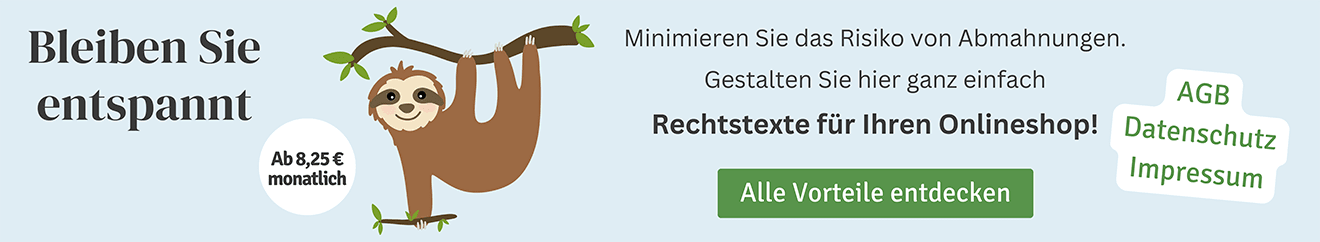Produktsicherheitsverordnung: Was Händler von Gebrauchtwaren und Antiquitäten wissen müssen
Am 13. Dezember 2024 ist die neue Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in Kraft getreten und hat weitreichende Änderungen für Händler mit sich gebracht. Doch welche Produkte sind betroffen? Während Antiquitäten und Sammlerstücke ausgenommen sind, gelten für Gebrauchtwaren, B-Ware und Upcycling-Produkte strenge Vorschriften - und die stellen Händler vor große Herausforderungen. Geht es Ihnen genauso? Keine Sorge! In diesem Artikel erfahren Sie, ob Ihre Upcycling-, DIY-, Gebrauchtwaren- und Antiquitätenprodukte unter die neue Verordnung fallen. Außerdem verraten Ihnen unsere Experten, wie Sie trotz der verwirrenden Rechtslage Ihre Produkte kennzeichnen und rechtliche Stolperfallen geschickt umgehen können.
Das Wichtigste in Kürze
- Neue Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Betrifft seit dem 13. Dezember 2024 alle Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind.
- Betroffene Produktgruppen: Neben Neuware gelten die Vorschriften auch für Gebrauchtwaren, B-Ware, Upcycling-Produkte sowie reparierte und wiederaufgearbeitete Produkte.
- Ausnahmen: Antiquitäten, Kunstgegenstände und Sammlerstücke sind von den Regelungen ausgenommen, sofern sie klar als solche ausgewiesen sind.
- Kennzeichnungspflichten: Händler müssen genaue Angaben zu Herstellern machen. Bei unbekanntem oder nicht mehr existierendem Hersteller kann dies problematisch werden.
- Rechtliche Herausforderungen für Gebrauchtwarenhändler: Die Verordnung stellt hohe Anforderungen, insbesondere bei schwer zu ermittelnden Herstellerangaben. Unsere Anwälte bieten Ihnen praktische Tipps, wie Sie mit den Anforderungen der GPSR umgehen können, auch wenn eine vollständige Umsetzung nicht immer möglich ist.
- Politischer Ausblick: Die Zukunft der GPSR ist noch nicht in Stein gemeißelt – es gibt viele offene Fragen und politische Diskussionen.
Was ist die Produktsicherheitsverordnung?
Neue Regelungen für Onlinehändler: Am 13.12.2024 ist europaweit die neue Produktsicherheitsverordnung in Kraft getreten. Worum es geht, was sich für Onlinehändler ändert und wie Sie sich vorbereiten können, finden Sie in unserem Überblick über die Neuerungen der Produktsicherheitsverordnung
In diesem Artikel gehen wir darauf ein, welche Anforderungen die neue Produktsicherheitsverordnung für Gebrauchtwarenhändler und Antiquitätenhändler mit sich bringt und wie Sie damit umgehen können.
Welche Produkte sind betroffen?
Die neuen Vorschriften gelten zunächst umfassend für alle Produkte, die zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt sind. Die gesetzliche Definition findet sich in Artikel 3 Nr. 1 GPSR – danach betrifft die Verordnung...
jeden Gegenstand, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen Gegenständen entgeltlich oder unentgeltlich — auch im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung — geliefert oder bereitgestellt wird und für Verbraucher bestimmt ist oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen wahrscheinlich von Verbrauchern benutzt wird, selbst wenn er nicht für diese bestimmt ist.
Natürlich gilt die Verordnung zunächst für alle NEU hergestellten Produkte. Dabei gibt es aber Ausnahmen, besondere Produktgruppen und auch Abgrenzungsprobleme. Als Hilfestellung soll unsere folgende Auflistung dienen:
Besondere Produktgruppen, für die die Produktsicherheitsverordnung gilt
Upcycling
Die GPSR gilt auch, wenn ein Hersteller ein Produkt aus mehreren (eventuell gebrauchten) Teilen zusammensetzt, das Ergebnis aber als neues Produkt anbietet. Dann gilt das gesamte hieraus hergestellte Produkt rechtlich als Neuware. Diese Neuware unterfällt der GPSR.
Beispiel: Sie basteln aus gebrauchten Einmachgläsern dekorative Lampen. Obwohl die Gläser bereits im Umlauf waren, gelten die fertigen Lampen als „neue“ Produkte, da sie in ihrer neuen Funktion zuvor nicht existierten. Ab dem 13.12.2024 fallen solche DIY-Upcycling-Projekte ebenfalls unter die GPSR wie jedes andere neu hergestellte Produkt.
„B-Ware“, „2. Wahl“, „Retourenware“
Manche Verkäufer bieten „B-Ware“ (oder auch „2. Wahl“, „Retourenware“ o.ä.) an. Dabei handelt es sich um Produkte, die zwar voll funktionstüchtig sind, aber kleinere Mängel haben (z.B. leicht beschädigte Verpackung, oberflächliche Verfärbungen, leichte Gebrauchsspuren). Die GPSR gilt für solche „B-Ware“ genauso wie für fehlerfreie Neuware. Das bedeutet: Auch B-Ware muss genau so sicher sein (nicht genauso schön) wie die erste Wahl; und es gelten dieselben Informationspflichten.
Gebrauchte, reparierte oder wiederaufgearbeitete Produkte
Die Vorschriften der GPSR gelten auch für „gebrauchte, reparierte und wiederaufgearbeitete Produkte“ (Artikel 2 Absatz 3 GPSR). Dies triff zu, wenn:
- diese von einem Unternehmen nach dem 12. 12. 2024 erneut in den Wirtschaftsverkehr gebracht werden und
- sie noch (oder wieder) bestimmungsgemäß benutzbar sind.
Produktgruppen, für die die Produktsicherheitsverordnung NICHT gilt
Defekte Produkte
Die GPSR gilt nicht für:
„Produkte, von denen Verbraucher vernünftigerweise nicht erwarten können, dass sie aktuelle Sicherheitsnormen erfüllen, beispielsweise Produkte, die ausdrücklich als Produkte mit Reparatur- oder Wiederaufarbeitungsbedarf dargestellt oder als Sammlerstücke von historischer Bedeutung auf dem Markt bereitgestellt werden"
...so der Text der Vorschrift. Wenn also ein Produkt als „defekt“, „zum Ausschlachten“, „als Ersatzteillager“ oder „ohne Funktion – nur zur Dekoration“ beworben wird, unterfällt es nicht den Anforderungen der GPSR.
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Sammlerstücke
Die Produktsicherheitsverordnung gilt nicht für Antiquitäten. Leider aber enthält die Verordnung keine unmittelbare Definition, was im Sinne der GPSR als „Antiquität“ zu verstehen ist. An einer Stelle verweist die Verordnung aber auf den Anhang IX der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Richtlinie 2006/112/EG). Dieser Anhang enthält eine Definition für Antiquitäten.
Antiquitäten sind danach...
- alle Gegenstände, die älter sind als 100 Jahre,
- Kunstgegenstände (unabhängig vom Alter) und
- Sammlungsstücke (unabhängig vom Alter).
Bei Gegenständen mit einem Alter von über 100 Jahren brauchen also keine weiteren Voraussetzungen erfüllt zu werden. Es genügt das hohe Alter, um aus den Vorschriften der Produktsicherheitsverordnung herauszufallen. Ob ein Gegenstand älter als 100 Jahre ist, muss der Händler im Zweifel belegen können.
Bei den Kunstgegenständen kommt es auf das Alter nicht an. Sie können also auch neu hergestellt sein. Zu den Kunstgegenständen zählen laut Definition des oben genannten Anhangs IX
- Gemälde (z.B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen sowie Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke, vollständig vom Künstler mit der Hand geschaffen, ausgenommen Baupläne und -zeichnungen, technische Zeichnungen und andere Pläne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, topografischen oder ähnlichen Zwecken, handbemalte oder handverzierte gewerbliche Erzeugnisse, bemalte Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe oder dergleichen,
- Originalstiche, -schnitte und -steindrucke, die unmittelbar in begrenzter Zahl von einer oder mehreren vom Künstler vollständig handgearbeiteten Platten nach einem beliebigen, jedoch nicht mechanischen oder fotomechanischen Verfahren auf ein beliebiges Material in schwarz-weiß oder farbig abgezogen wurden,
- Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art, sofern vollständig vom Künstler geschaffen; unter Aufsicht des Künstlers oder seiner Rechtsnachfolger hergestellte Bildgüsse bis zu einer Höchstzahl von acht Exemplaren,
- handgearbeitete Tapisserien und Textilwaren für Wandbekleidung nach Originalentwürfen von Künstlern, höchstens jedoch acht Kopien je Werk,
- Originalwerke aus Keramik, vollständig vom Künstler geschaffen und von ihm signiert,
- Werke der Emaillekunst, vollständig von Hand geschaffen, bis zu einer Höchstzahl von acht nummerierten und mit der Signatur des Künstlers oder des Kunstateliers versehenen Exemplaren (ausgenommen sind Erzeugnisse des Schmuckhandwerks, der Juwelier- und der Goldschmiedekunst) und
- vom Künstler aufgenommene Photographien, die von ihm oder unter seiner Überwachung abgezogen wurden und signiert sowie nummeriert sind; die Gesamtzahl der Abzüge darf, alle Formate und Trägermaterialien zusammengenommen, 30 nicht überschreiten.
Zu den „Sammlungsstücken“ zählen gemäß Anhang IX, ebenfalls unabhängig vom Alter,
- Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, Ganzsachen und dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, jedoch weder gültig noch zum Umlauf vorgesehen, und
- zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungsstücke und Sammlungen; Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert.
Etwas verwirrend ist in diesem Zusammenhang, dass also auch neu hergestellte Kunstgegenstände und frisch gedruckte Briefmarken im rechtlichen Sinne als „Antiquitäten“ gelten, obwohl sie – entgegen der Wortbedeutung – nicht antik sind. Aber daran hat sich der Gesetzgeber offenbar nicht gestört.
Probleme im Zusammenhang mit Gebrauchtwaren
Die Produktsicherheitsverordnung gilt zwar nicht für Antiquitäten, aber sie gilt für alle anderen Gebrauchtwaren, die vielleicht erst 20 oder 30 Jahre alt sind („Vintage“).
Für Händler von Gebrauchtwaren ergeben sich im Zusammenhang mit den Informationspflichten besondere Probleme, mit denen wir uns im Folgenden befassen:
- wenn der Hersteller unbekannt ist,
- wenn der Hersteller nicht mehr existiert, und
- wenn der Hersteller keine elektronische Adresse hat.
Problematisch ist, dass die Produktsicherheitsverordnung für alle diese Fälle keine brauchbare Lösung anbietet. Nach dem Wortlaut der Produktsicherheitsverordnung muss ein Händler selbst dann alle Daten zum Hersteller angeben, wenn dieser für ein gebrauchtes Produkt beim besten Willen nicht mehr ermittelbar ist oder wenn der Hersteller nicht mehr existiert. Es dürfte einleuchten, dass dies eine unerfüllbare Forderung ist. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Autoren der Verordnung die Besonderheiten für Gebrauchtwaren schlicht übersehen haben.
Hersteller ist unbekannt
Problem
Wer schon einmal in einem Trödelladen oder auf einem Flohmarkt war, weiß, dass man bei den meisten der angebotenen Sachen nicht mehr herausfinden kann, wer sie ursprünglich einmal hergestellt hat. Gerade bei Geschirr, Küchenzubehör, Kleinmöbeln, Lampen, Bilderrahmen, Spiegeln und Dekorationsartikeln findet sich nur selten irgendeine Herstellerangabe.
Ausnahmen mögen bestehen bei hochwertiger Markenware, die mittels ihres Markenzeichens einen Hinweis auf den Hersteller geben, z.B. Meissener Porzellan (Markenzeichen: gekreuzte Schwerter auf der Unterseite).
Die Produktsicherheitsverordnung sieht vor, dass Sie den Hersteller auch in den Fällen nennen, in denen kein Hinweis auf den Hersteller vorhanden ist.
Lösungsvorschlag
Versuchen Sie zunächst mit den Ihnen möglichen Mitteln, den Hersteller festzustellen. Befindet sich am Produkt ein Markenzeichen, können Sie versuchen, den zugehörigen Markeninhaber zu ermitteln – dieser gilt im Sinne der Produktsicherheitsverordnung als Hersteller. Wenn Sie ein Foto des Markenzeichens machen, können Sie es zum Beispiel auf im Markenrecherche-Tool TMview hochladen, um den Markeninhaber herauszufinden. Das Tool liefert Ihnen Namen und Anschriften der Markeninhaber.
Wenn Sie beim besten Willen keinen Hersteller ermitteln können, dürfte die Angabe des Herstellers im rechtlichen Sinne „unmöglich“ sein. Eine gesetzliche Pflicht, deren Erfüllung objektiv unmöglich ist, führt aber nach allgemeinen rechtlichen Regeln nicht zu Bußgeldern oder sonstigen Sanktionen.
Wenn Sie schon keinen Hersteller benennen können, sollten Sie auf diesen Umstand in der Produktbeschreibung aber zumindest hinweisen, z.B. mit folgender Formulierung:
„Gebrauchtware – Hersteller nicht ermittelbar“
Damit zeigen Sie, dass Sie die Verordnung durchaus zur Kenntnis genommen haben und ihren Vorgaben nachkommen würden, wenn es denn ginge – aus unserer Sicht ist dies die einzig machbare Lösung. Ansonsten bestünde ja nur noch die Option, bestimmte Waren überhaupt nicht mehr verkaufen, sondern sie zu vernichten. Und das wäre wohl kaum im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der EU.
Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Rechtliche Risiken“ unten.
Hersteller existiert nicht mehr
Problem
Gerade bei älteren Produkten kann es vorkommen, dass ein früherer Hersteller inzwischen seinen Betrieb aufgegeben hat oder durch Insolvenz vom Markt verschwunden ist.
In diesem Fall ist zwar ein (ursprünglicher) Hersteller bekannt, aber diese Information ist für einen Verbraucher nicht mehr besonders hilfreich, wenn man den Zweck der Produktsicherheitsverordnung bedenkt: Danach soll die Herstellerangabe vor allem dazu dienen, den Hersteller im Falle von schwerwiegenden Produktmängeln zur Verantwortung zu ziehen.
Die Angabe eines Herstellers, der nicht mehr existiert, könnte vor diesem Hintergrund als irreführend aufgefasst werden.
Lösungsvorschlag
Versuchen Sie zunächst festzustellen, ob der Hersteller eventuell nur seinen Namen geändert hat oder von einem anderen Unternehmen übernommen worden ist. Eine Arbeitshilfe hierfür kann die Datenbank northdata.de sein. Dort können Sie mit einem leicht zu bedienendes Suchformular Namensänderungen und Nachfolgeunternehmen recherchieren.
Wenn Ihre Recherche ergebnislos verläuft, bleibt nur die Option, dass Sie den früheren Hersteller mit den zuletzt bekannten Daten aufführen und den Hinweis ergänzen, dass das Unternehmen nicht mehr existiert, z.B. so:
„Hersteller: ... GmbH, ....-straße .., 12345 Musterstadt – Dieser frühere Hersteller existiert nicht mehr.“
Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Rechtliche Risiken“ unten.
Hersteller hat keine elektronische Kontaktadresse
Problem
Die Produktsicherheitsverordnung sieht vor, dass Händler neben dem Namen und der Adresse des Herstellers auch dessen „elektronische Kontaktadresse“ (Webseiten-URL oder E-Mail-Adresse) angeben. Gerade bei älteren Produkten kann es vorkommen, dass ein Hersteller zum damaligen Zeitpunkt noch gar keine Webseite oder E-Mail-Adresse hatte und diese daher auch nicht auf dem Produkt oder seiner Verpackung aufgedruckt sind.
Lösungsvorschlag
Versuchen Sie zunächst festzustellen, ob der Hersteller inzwischen eine Webseite hat. Eine einfache Internetrecherche sollte darüber Klarheit bringen. Sie können sodann die Adresse (URL) der gefundenen Hersteller-Webseite nennen, alternativ die E-Mail-Adresse, die der Hersteller in seinem Impressum angibt.
Wenn Ihre Recherche ergebnislos verläuft, können Sie nur angeben, dass für den Hersteller keine elektronische Kontaktadresse bekannt ist, z.B. so:
„Hersteller: ... GmbH, ....-straße .., 12345 Musterstadt – Der Hersteller hat keine elektronische Kontaktadresse.“
Damit zeigen Sie, dass Ihnen die Verordnung geläufig ist, Sie aber keine elektronische Kontaktadresse nennen können, wenn der Hersteller nun einmal keine solche hat.
Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Rechtliche Risiken“ unten.
Rechtliche Risiken
Alle unsere oben dargestellten Lösungsvorschläge sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass die GPSR bisher keine rechtssichere Lösung für diese Konstellationen anbietet – außer, auf den Verkauf der betroffenen Produkte ganz zu verzichten. Das wäre der sicherste Weg, aber für die meisten Händler sicher nicht akzeptabel. Daher haben wir Ihnen oben die jeweiligen Alternativen aufgezeigt, für die wir aber keine Gewähr übernehmen können.
Wir gehen davon aus, dass die EU-Kommission demnächst noch Klarstellungen und konkrete Handlungsempfehlungen veröffentlichen wird. Eine solche Veröffentlichung könnte die Rechtslage klären oder zumindest für bessere Orientierung sorgen.
Politische Diskussion und Ausblick
Wir haben von vielen unserer Mandanten die Rückmeldung erhalten, dass die Recherche nach Herstellerinformationen bei Gebrauchtwaren einen erheblichen, teils auch unzumutbaren Arbeitsaufwand bedeutet. Wir verstehen den Unmut der betroffenen Händler sehr gut. Aus unserer Sicht ist die unbefriedigende Situation verursacht durch eine nicht ausreichend durchdachte Regulierung.
Inzwischen beschäftigt sich auch das Europäische Parlament mit dem Problem.
So hat die EU-Parlamentarierin Virginie Joron am 20.9.2024 folgende schriftliche Anfrage an die EU-Kommission eingereicht:
„Die europäische Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) soll am 13.12.2024 in Kraft treten und hat eine Flut von Forderungen an Verkäufer von Amazon und anderen Marktplätzen ausgelöst. Es besteht die Gefahr, dass dadurch Tausende von gebrauchten, alten und seltenen Artikeln nicht mehr zum Verkauf angeboten werden können. Dies könnte erhebliche Folgen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), aber auch für die kulturelle Vielfalt und die Kaufkraft der Verbraucher haben.
Die Verordnung gilt nicht für Antiquitäten oder Produkte wie Sammlerstücke oder Kunstwerke, von denen die Verbraucher vernünftigerweise nicht erwarten können, dass sie neueren Sicherheitsstandards entsprechen.
- Welche Schritte hat die Kommission unternommen, um sicherzustellen, dass die von den großen Marktplätzen im Rahmen der GPSR angewandten Verfahren nicht indirekt kleine Unternehmen ausschließen, die gebrauchte Kulturgüter verkaufen?
- Ist die Kommission der Ansicht, dass CDs, DVDs und Videospiele, die weniger als 100 Jahre alt sind, unter die Ausnahmeregelung für Antiquitäten fallen, da sie wie Briefmarken gesammelt werden können, oder ist sie der Ansicht, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen?“
Eine ähnliche Anfrage hat der EU-Parlamentarier Thierry Mariani am 26.9.2024 gestellt:
„Die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), die am 13.12.2024 in Kraft treten soll, bereitet den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Kultursektor, insbesondere denjenigen, die sich auf den Verkauf von Büchern, CDs, DVDs und Videospielen spezialisiert haben, zunehmend Sorgen. Da ein Großteil ihres Geschäfts aus dem Verkauf von alten oder gebrauchten Produkten besteht, sehen sie sich mit unverhältnismäßigen Anforderungen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit und die Kennzeichnung von Artikeln, die kein nennenswertes Sicherheitsrisiko für die Verbraucher darstellen.
Infolgedessen befürchten viele KMU, dass sie die neuen Vorschriften nicht einhalten können und möglicherweise schließen müssen, was zu einem weniger vielfältigen kulturellen Angebot in Europa führen würde.
Beabsichtigt die Kommission daher, die GPSR zu ändern, um Kulturprodukte aus ihrem Anwendungsbereich auszuschließen, oder ihre Anwendung auf Produkte zu beschränken, die nach dem 13.12.2024 in Verkehr gebracht werden, um diese Unternehmen zu schützen und gleichzeitig die Ziele der Verbrauchersicherheit zu erfüllen?“.
Sie sehen: Auch das EU-Parlament ist unzufrieden mit den Definitionen und Regelungen, die die GPSR im Zusammenhang mit Gebrauchtwaren mit sich bringt. Der Abgeordnete Mariani fragt sogar konkret an, ob die GPSR noch geändert wird angesichts der praktischen Schwierigkeiten ihrer Umsetzung.
Wir verfolgen die Problematik weiter und werden unsere Mandanten natürlich informieren, sobald es hier neue Entwicklungen gibt.
Sie möchten auch informiert werden? Diesen Service bieten wir allen, die unsere Rechtstexte nutzen. Er ist Teil unseres Update-Services, mit dem wir die AGB und Datenschutzerklärungen unserer Mandanten auf dem aktellen Stand halten.