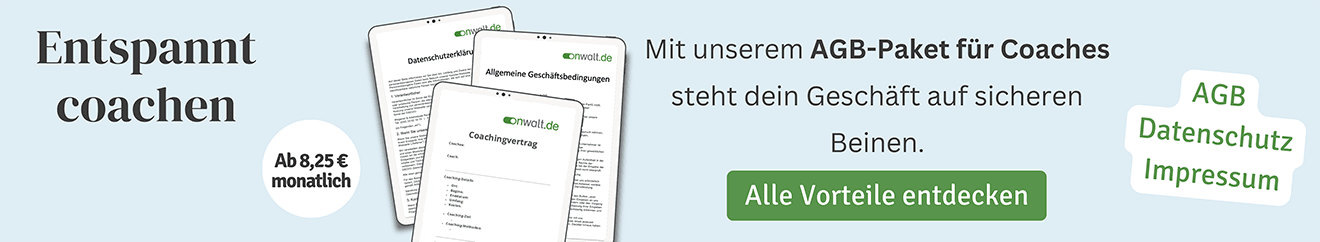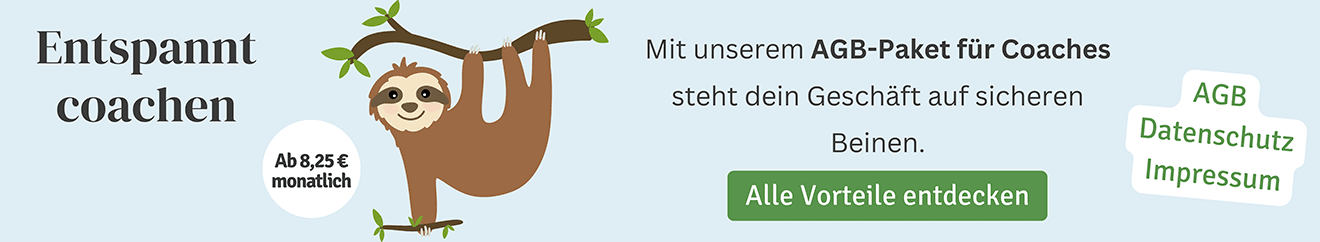Rechtssicher Coachen - Praxisguide zu Vertrag, Widerruf, Werbung & Co.
Du unterstützt andere, ihr Leben zu ordnen, ihre Ziele zu erreichen oder ihre innere Stimme wiederzufinden – das ist toll. Wenn du damit Geld verdienst, dann ist rechtliche Klarheit genauso wichtig wie Intuition, Empathie und Fachwissen.
Dafür brauchst du kein Jura-Diplom. Aber du solltest wissen, wo du hinschauen musst – zum Beispiel, wenn es ums Widerrufsrecht geht, um das Thema Datenschutz oder um die Frage „Darf ich sagen, dass mein Coaching bei Burnout hilft?“.
In diesem Artikel zeigen wir dir ganz konkret:
- was du brauchst, um rechtlich sicher aufgestellt zu sein
- wo echte Stolperfallen lauern (und wie du sie vermeidest)
- und: Wie du dich schützt, ohne deine Leichtigkeit zu verlieren
Rechtliche Voraussetzungen für Coaches – ein Überblick
Wir geben dir einen Überblick über die rechtlichen Voraussetzungen für Coaches. Denn ob du Einzelcoachings gibst, Gruppenkurse leitest oder Online-Material verkaufst, du bist geschäftlich tätig. Dabei gibt es eindeutige Regeln.
Die gute Nachricht: Wenn du weißt, worauf du achten musst, ist das machbar. Wir zeigen dir, wie.
Widerrufsrecht beim Coaching – ja, das gilt auch für dich
Wann gilt das Widerrufsrecht beim Coaching?
Sobald du dein Coaching online buchbar machst – etwa per Website, Buchungstool oder Bezahllink – handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag (§ 312c BGB). Ähnlich ist es bei Coaching-Verträgen, die persönlich abgeschlossen werden, aber außerhalb deiner Geschäftsräume – etwa in einem Café oder bei einem Hausbesuch. Dann handelt es sich um einen „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag“ (§ 312b BGB). In beiden Fällen gilt das Verbraucher-Widerrufsrecht (§ 312g Absatz 1 BGB).
14 Tage Widerrufsrecht – auch bei Online-Coachings
Die Einzelheiten des Widerrufsrechts regelt § 355 BGB: Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht, und zwar auch dann, wenn das Coaching online oder telefonisch stattfindet.
Wer ist überhaupt Verbraucher – und wer nicht?
Verbraucher ist, wer eine Leistung nicht für seine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit in Anspruch nimmt (§ 13 BGB). und nicht im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit. Wenn deine Klienten das Coaching im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit buchen, gelten sie rechtlich als Unternehmer (§ 14 BGB) – und Unternehmer haben kein gesetzliches Widerrufsrecht.
Achtung bei gemischter Zielgruppe
Mitunter kann es Zweifelsfälle geben: Stell dir vor, du bietest Coaching im Bereich Verhandlungstechniken an. Das könnte für einen Selbständigen interessant sein, um seine Position bei den nächsten Einkaufsverhandlungen zu verbessern. Andererseits kann auch ein Arbeitnehmer das Coaching buchen, um sich auf das nächste Personalgespräche oder eine Gehaltsverhandlung vorzubereiten.
Tipp: Status im Buchungsprozess abfragen
Wenn du also ein Coaching anbietest, dass sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen in Frage kommt, achte darauf, den Status des Bestellers im Buchungsprozess abzufragen – zum Beispiel über eine entsprechende Auswahloption – und im Vertrag festzuhalten.
Sofort loslegen? Bei Verbrauchern nur mit Zustimmung und Hinweis
Dein Klient will schon vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit dem Coaching starten? Dann achte auf folgende Voraussetzungen:
- die ausdrückliche Zustimmung des Klienten, dass das Coaching vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt (§ 356 Absatz 4 BGB)
- den klaren Hinweis auf der Checkout-Seite, dass das Widerrufsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung erlischt – also sobald das Coaching komplett durchgeführt ist
In der Praxis lässt sich das am besten über eine Checkbox direkt über dem Buchungsbutton lösen, zum Beispiel so:
Übrigens: Widerruft dein Klient den Coaching-Vertrag, während das Coaching noch nicht vollständig durchgeführt worden ist, hast du Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die bereits erbrachte (Teil-)Leistung. Du erhältst also ein zeitanteiliges Honorar.
Heilversprechen & Coaching – wo die Grenze zur Therapie verläuft
Eine Werbeaussage wie „Mein Coaching hilft bei Depressionen“ – klingt gut, ist aber riskant. Denn sobald du Heilwirkungen versprichst, bewegst du dich im Bereich des Heilmittelwerbegesetzes (HWG). Solche gesundheitsbezogenen Aussagen dürfen nur Personen machen, die zur Ausübung der Heilkunde befugt sind – also z. B. approbierte Ärzte oder Heilpraktiker mit Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Für Coaches ohne Heilerlaubnis ist das also verboten.
besser:
„Ich unterstütze dich dabei, deine Stressmuster zu erkennen und neue Wege im Umgang damit zu finden.“
Damit bleibst du auf der sicheren Seite – fachlich wie rechtlich.
Irreführende Werbung: Was noch unzulässig ist
Nicht nur Heilversprechen sind problematisch. Auch Aussagen, die übertriebene oder nicht belegbare Erfolge suggerieren, können rechtlich angreifbar sein – zum Beispiel unter dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (§ 5 UWG). Wenn du etwa schreibst „Dieses Coaching löst deine Blockaden in 7 Tagen“, brauchst du dafür eine belastbare, objektiv verifizierbare Grundlage – sonst drohen Abmahnungen. Zur Orientierung hilft hier: formuliere realistisch, transparent, objektiv überprüfbar und ohne Übertreibung.
Heilpraktikergesetz – was Coaches beachten müssen
Das Heilpraktikergesetz (HeilprG) (§ 1) verbietet die Ausübung von Heilkunde ohne Erlaubnis. Heißt für dich: Sobald dein Coaching therapeutische Methoden nutzt, Diagnosen stellt oder Behandlungen simuliert, kann das rechtlich heikel werden.
Klarheit schaffst du mit einem eindeutigen Wording auf deiner Website („Coaching ersetzt keine Therapie“) – und damit, dass du deine Klienten bei Bedarf an passende Fachpersonen verweist. Diese bewusste Abgrenzung ist nicht nur rechtlich wichtig, sondern zeigt auch Verantwortungsbewusstsein.
Siehe auch: Heilpraktikergesetz im Volltext
ZFU-Zulassung – betrifft dich das?
Wenn du einen Onlinekurs oder ein Selbstlernprogramm anbietest, kann dein Angebot unter das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) fallen. In dem Fall brauchst du unter Umständen eine Zulassung durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) – bevor du das Angebot vertreibst.
Wann brauchst du eine ZFU-Zulassung?
Laut § 1 Absatz 1 FernUSG liegt Fernunterricht vor, wenn:
- Kenntnisse oder Fähigkeiten auf vertraglicher Grundlage vermittelt werden,
- dies entgeltlich geschieht,
- Lehrende und Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind, und
- der Lernerfolg durch den Lehrenden oder eine beauftragte Person überwacht wird.
Die ZFU stellt zudem die Kriterien „zielgerichtet“ und „strukturiert“ an ein Fernunterrichts-Angebot: Ein Kurs gilt dann als zulassungspflichtig, wenn er didaktisch geplant, inhaltlich aufgebaut und auf einen nachweisbaren Lernerfolg ausgerichtet ist. Reine Impulsformate oder offene Gesprächsrunden fallen in der Regel nicht darunter.
Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, gilt dein Angebot als Fernunterricht – und ist nur mit der vorgesehenen Zulassung erlaubt.
Im Rahmen eines Coachings wird normalerweise kein „Lernerfolg überwacht“. Mit einer Überwachung des Lernerfolgs meint das FernUSG, dass ein Teilnehmer regelmäßig schriftliche Arbeiten einreichen muss und der Anbieter sich verpflichtet, „die eingesandten Arbeiten innerhalb angemessener Zeit sorgfältig zu korrigieren und dem Teilnehmer am Fernunterricht diejenigen Anleitungen zu geben, die er erkennbar benötigt“. Es geht also um eine regelmäßige Evaluation des Lernfortschritts und um gezielte Unterstützung, um ein Lernziel zu erreichen.
Hinweis: Auch unentgeltlicher Fernunterricht, der berufliche Bildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, unterfällt dem Zulassungserfordernis (§ 1 Absatz 2 FernUSG, § 15 FernUSG). Aber das ist für Dich als Coach eher nicht relevant.
Aufgepasst bei Präsenzangeboten mit Online-Zuschaltung
Auch wenn dein Kurs eine Präsenzveranstaltung ist, kann er rechtlich als Fernunterricht gelten – zum Beispiel, wenn sich Teilnehmer per Video zuschalten.
Die Rechtsprechung ist in diesem Punkt allerdings nicht einheitlich – vor allem, was die „räumliche Trennung“ betrifft. Manche Gerichte sehen bereits eine digitale Zuschaltung als trennend an, andere stellen ab auf didaktische Gestaltung und Zielgruppe. Umso wichtiger ist es, dass du dein Konzept gut dokumentierst – und im Zweifel rechtlich prüfen lässt.
Coachingvertrag: Dienstvertrag, nicht Werkvertrag
Coachingverträge werden in der Regel als Dienstverträge (§ 611 BGB) eingeordnet. Das bedeutet: Du schuldest deinen Klienten eine fachlich kompetente und sorgfältige Leistung – aber keinen konkreten Erfolg. Deine Aufgabe ist es also nicht, das vom Klienten angestrebte Ergebnis sicherzustellen (zum Beispiel einen beruflichen Erfolg oder die Versöhnung mit einem Partner), sondern dein Wissen, deine Methoden und deine Erfahrung bestmöglich einzusetzen. Inwiefern dein Klient deine Meinung teilt, deine Anregungen annimmt oder Ratschläge befolgt, ist allein seine Sache.
Wichtig wird diese Unterscheidung dann, wenn du in deinem Angebot oder Vertrag bestimmte Erfolge in Aussicht stellst – etwa „Nach dem Coaching wirst du garantiert befördert“ oder „Mit meinem Programm bekommst du deinen Traumjob“. Solche Aussagen bergen das Risiko, dass der Vertrag rechtlich als Werkvertrag nach § 631 BGB eingeordnet wird. Und das hätte weitreichende Folgen: Denn bei einem Werkvertrag schuldest du das Ergebnis – inklusive der Pflicht zur Nachbesserung oder sogar zur Rückzahlung, wenn der „Erfolg“ ausbleibt.
Datenschutz: ein Muss, auch im Coaching
Wenn du mit Menschen arbeitest, erfährst du oft sehr Persönliches. Und sobald du Klientdaten erhebst, speicherst oder weitergibst, gelten die Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Du brauchst:
- eine Datenschutzerklärung auf deiner Website
- Datenschutzhinweise für deine geschäftlichen Social-Media-Kanäle
- Auftragsverarbeitungsverträge mit Tools für Videokonferenzen, Terminsuche oder Cloud-Speicher
- und je nach Kontext auch eine ausdrückliche Einwilligung (z. B. für Aufzeichnungen)
- Achte darauf, dass die Tools, mit denen du arbeitest, sich datenschutzkonform einsetzen lassen – bevorzuge im Zweifel Anbietern mit Sitz in der EU.
Du brauchst Unterstützung bei deinen Rechtstexten?
Dann schau dir unser rechtssicheres Coaching-AGB-Paket an. Speziell für Coaches gemacht, juristisch geprüft, sofort einsetzbar. Unsere Rechtstexte für Coaches enthalten:
- ein Vertragsmuster für individuelle Vereinbarungen (z.B. Ort und Dauer des Coachings)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Datenschutzhinweise für deine Webseite
- und eine auf dein Geschäft abgestimmte Widerrufsbelehrung.
- Unsere Anwälte beraten dich persönlich, wenn du Fragen zu deinen Rechtstexten hast.
Du stehst am Anfang deiner Selbstständigkeit? Dann wirf doch mal einen Blick in unsere onwalt-Akademie. Dort findest du viele hilfreiche Artikel rund ums Gründen, zu steuerlichen Pflichten und allem, was du rechtlich brauchst, damit dein Business sicher startet – und sicher wächst.
Rechtsnormen
§ 611 BGB (Dienstvertrag)
§ 356 BGB (Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen)
§ 3 HWG (Irreführende Werbung für Behandlungen)
§ 1 FernUSG (Definition des Fernunterrichts)